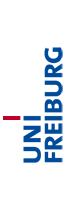Konkrete Ausgestaltung der mündlichen Prüfung
Hier finden Sie Informationen zur konkrete Ausgestaltung der mündlichen Abschlussprüfung am Deutschen Seminar.
2. Grundlagen- und Überblickswissen
3. Unterschiede zwischen Hauptfach- und Beifachprüfung
Wird im Bereich "Sprachwissenschaft" das Gebiet "Sprachgeschichte" als Prüfungsgebiet gewählt, was nur für Hauptfachstudierende vorgesehen ist, so kommt dafür ein Prüfer bzw. eine Prüferin aus der Germanistischen Linguistik oder aus der Germanistischen Mediävistik in Frage, da erwartet wird, dass die erworbenen Kompetenzen im Bereich Sprachgeschichte "von den Anfängen bis zur Gegenwart" reichen und Schwerpunkte im Mittelhochdeutschen und in einer weiteren Sprachentwicklungsstufe des Deutschen gebildet werden sollten. Auch wenn das Thema von einem Vertreter bzw. einer Vertreterin aus der Germanistischen Mediävistik geprüft wird, muss gemäß Anlage A der GymPO I ein Vergleich zum Gegenwartsdeutschen Prüfungsthema sein.
Wird dagegen ein Thema aus dem Gebiet "Sprache als System" oder aus dem Gebiet "Sprache als Mittel der Kommunikation" als Prüfungsthema gewählt, kommt nur ein Prüfer bzw. eine Prüferin aus der Germanistischen Linguistik in Frage.
In der Literaturwissenschaft kann bei dem Schwerpunktthema "Literatur vor 1850" ein Themenfeld aus der Neueren deutschen Literaturwissenschaft oder aus der Germanistischen Mediävistik gewählt werden. Das komplementäre Themenfeld aus dem Gebiet "Literatur nach 1850" kann dagegen nur von einem Prüfer bzw. einer Prüfer aus der Neueren deutschen Literaturwissenschaft geprüft werden.
Die mündliche Prüfung kann also in den Händen von zwei oder von drei Prüfern liegen. Die möglichen Prüfungsszenarien finden Sie in dieser Übersicht.
2. Grundlagen- und Überblickswissen:
Der 15minütigen Prüfungsteil zu Grundlagen- und Überblickswissen wird von den Prüfern bzw. Prüferinnen übernommen, die die Schwerpunktthemen geprüft haben. Es kommt also kein neuer Prüfer bzw. keine neue Prüferin aus einem Teilgebiet der Germanistik hinzu, das durch die Wahl der Prüfungsthemen noch nicht in der mündlichen Prüfung vertreten war. Zudem haben die Prüfer des Deutschen Seminars beschlossen, dass zur Prüfung des „Grundlagen- und Überblickswissens“ von den Prüfern bzw. Prüferinnen immer drei kurze sprachliche oder literarische bzw. textbildliche Beispiele zur Analyse vorgelegt werden, wobei Folgendes gilt: Sind in der Prüfung drei Prüfer bzw. Prüferinnen vertreten, legt jeder bzw. jede ein Beispiel zur Prüfung des Grundlagen- und Überblickswissens aus seinem bzw. ihrem Teilfach vor; die Prüfungszeit beträgt je fünf Minuten. Sind nur zwei Prüfer bzw. Prüferinnen vertreten, legt der Prüfer bzw. die Prüferin, der bzw. die zwei Schwerpunktthemen prüfte, zwei Beispiele zu seinem Teilfach vor; ihm bzw. ihr stehen dafür 10 Minuten der 15minütigen Prüfungszeit zur Verfügung. Eine fachfremde Prüfung in einem Teilfach, das von den Prüfern bzw. Prüferinnen nicht vertreten wird, findet nicht statt!
3. Unterschiede zwischen Hauptfach- und Beifachprüfung
Da in der Beifachprüfung weder die Sprachgeschichte noch die Literatur vor dem 18. Jahrhundert Prüfungsgegenstände sind, kommen für die beiden Schwerpunktthemen aus der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft nur Prüfer bzw. Prüferinnen aus der Germanistischen Linguistik bzw. aus der Neueren deutschen Literaturwissenschaft in Frage. Die Prüfung im Teil "Grundlagen und Überblickswissen" teilen sich diese beiden Prüfer.
Ca. ein Jahr vor dem anvisierten Prüfungstermin sollten Sie sich um Ihre Prüfer bzw. Prüferinnen bemühen. Wer im Lehramtsstudiengang prüfungsberechtigt ist, finden Sie iin der Liste der Prüfungsberechtigten. Für die Themen der Germanistischen Linguistik wird Ihnen ein Prüfer zugeteilt. Informationen zum Zuteilungsverfahren finden Sie hier. Prüfer bzw. Prüferinnen aus der Germanistischen Mediävistik bzw. der Neueren deutschen Literaturwissenschaft kontaktieren Sie bitte selbständig.