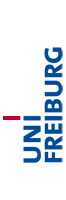Modul Vertiefung Neuere deutsche Literatur I – Historischer Überblick (4 ECTS-Punkte)
| FS | Veranstaltung | Art | P/WP | ECTS | SWS | PL | SL | Turnus |
| 3 o. 4 | Epochenvorlesung: Vom Humanismus bis zur Frühaufklärung | V | WP | 2 | 2 | Nachbereitende Vorlesungsmitschrift | zweijährig | |
| 3 o. 4 | Epochenvorlesung: Von der Aufklärung bis zur Romantik | V | WP | 2 | 2 | Nachbereitende Vorlesungsmitschrift | zweijährig | |
| 3 o. 4 | Epochenvorlesung: Vom Vormärz bis zum Expressionismus | V | WP | 2 | 2 | Nachbereitende Vorlesungsmitschrift | zweijährig | |
| Inhalte des Moduls |
Die Epochenvorlesungen dieses Moduls finden als viersemestriger Zyklus statt. Geboten wird ein Überblick über die Geschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. In sich abgeschlossene Vorlesungen erläutern in paradigmatischen Interpretationen bedeutende Werkprofile und erhellen die jeweils typischen Epochensignaturen in Diachronie und Synchronie. Berücksichtigt werden außerliterarische Kontexte (historische und soziokulturelle Zusammenhänge), komparatistische und intermediale Bezüge. In der Epochenvorlesung „Vom Humanismus bis zur Frühaufklärung“ wird die Geschichte der deutschen Literatur im 16. und 17. Jahrhundert behandelt. Die Entwicklung des Frühneuhochdeutschen zur Literatursprache im 16. Jahrhundert in Konkurrenz zum Neulatein wird anhand volkstümlicher Kleinformen (Lied, Dialog, Schwank) und umfänglicher Gattungen (Moralsatire, Schuldrama, Epos) rekonstruiert. Nachgezeichnet wird die Modernisierung der Literatur des 17. Jahrhunderts zu einer konkurrenzfähigen Dichtungssprache anhand spezifischer Werkprofile (Martin Opitz, Andreas Gryphius, Paul Fleming, Daniel Casper von Lohenstein) und gattungsgeschichtlicher Längsschnitte (Sonett, Tragödie). Die Epochenvorlesung „Von der Aufklärung bis zur Romantik“ behandelt in soziokultureller Perspektive vornehmlich die Literatur des 18. Jahrhunderts und die bedeutsame ‚Sattelzeit’ um 1800. Einen Schwerpunkt bildet die bedeutsame Rolle literarischer Werke bei der Formierung der neuen 'bürgerlichen' Wertewelt und der Genese 'bürgerlicher' Subjektivität. Drama (bürgerliches Trauerspiel) und Prosa (Roman), die wichtige Probleme 'bürgerlicher' Selbstverständigung behandeln und reflektieren, sollen als Leitgattungen herausgestellt werden. Im Zentrum stehen die Weimarer Klassik mit Goethe und Schiller und ihr Verhältnis zu Aufklärung und Romantik. Die Epochenvorlesung „Vom Vormärz bis zum Expressionismus“ behandelt die Literatur von 1830 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im europäischen Kontext. Ausgehend von stilgeschichtlichen Signaturen wie Biedermeier, Realismus und Moderne des 19. Jahrhunderts wird der Weg zum Stilpluralismus der klassischen Moderne nachgezeichnet. Erhellt wird so die Bedeutung dieses häufig vernachlässigten Jahrhunderts für die Entwicklung der Moderne deutlich, mit der eine Europäisierung der deutschen Literatur einhergeht. An zentralen Werkprofilen (Heinrich Heine, Georg Büchner, Karl Immermann, Charles Sealsfield, Adalbert Stifter, Gottfried Keller, Theodor Fontane, Gerhart Hauptmann, Stefan George, Hugo von Hofmannsthal) die maßgeblichen ästhetischen Konzepte (Epigonalität, Verklärung, Naturalismus) illustriert und differenziert. Die Epochenvorlesung „Von der Moderne bis zur Gegenwart“ stellt zunächst die Literatur der Weimarer Republik (Klassische Moderne und Neue Sachlichkeit) und des Exils dar. Dabei werden sowohl die Kontinuitäten als auch die Brüche zwischen beiden Epochen berücksichtigt. Im zweiten Teil wendet sich die Vorlesung zentralen Entwicklungslinien der Literatur nach 1945 zu. Zunächst behandelt die Vorlesung Autoren wie Benn, Jünger und Brecht, die auf ältere literarische Traditionen zurückgreifen. Danach werden die Gruppe 47 und die stil- und meinungsbildenden Autoren der ersten Stunde wie Böll und Grass behandelt. Am Beispiel von Max Frisch, Elias Canetti, Thomas Bernhard, Alexander Kluge, Heiner Müller, Christa Wolf und Volker Braun werden paradigmatisch Positionen der deutschsprachigen Literatur nach 1945 behandelt werden. Die Frage nach dem Anteil der DDR-Literatur und der Rolle der „Wende“ für die Literatur kommt dabei ebenso Bedeutung zu wie Überlegungen zum grundsätzlichen Formwandel, der durch die Anlehnung einiger Autoren (Rolf Dieter Brinkmann) an die Strategien der internationalen Postmoderne hervorgerufen wird. | |||||||
| Qualifikationsziele und angestrebte Kompetenzen |
| |||||||
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dr. Achim Aurnhammer | |||||||
| Dauer des Moduls | Zwei Semester | |||||||
| Teilnahmevoraussetzungen | Keine | |||||||
| Verwendbarkeit des Moduls | B.A.-Hauptfach "Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft" | |||||||
| Arbeitsaufwand des Moduls (Workload in Kontaktzeit und Selbststudium) | je 1 ECTS Kontaktzeit; je 1 ECTS Selbststudium zur Nachbereitung der Vorlesungsmitschrift.
| |||||||
| Sprache | Deutsch | |||||||